„Es gibt ein Heilmittel, das […] innerhalb weniger Jahre ganz Europa […] frei und glücklich machen könnte. Dieses Mittel besteht in der Erneuerung der europäischen Familie, oder doch eines möglichst großen Teils davon. Wir müssen ihr eine Ordnung geben, unter der sie in Frieden, Sicherheit und Freiheit leben kann. Wir müssen eine Art Vereinigter Staaten von Europa errichten.“ Winston Churchill, 1946
Schon seit Beginn der europäischen Einigung wird immer wieder die Forderung laut, die Vereinigten Staaten von Europa zu gründen. Auch Ursula von der Leyen sprach sich 2011 für eine supranationale Staatlichkeit der EU „nach dem Muster der föderalen Staaten Schweiz, Deutschland oder USA“ aus. Heute ist von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin und steht für eine supranationale Institution, die in den letzten Jahren stetig an Einfluss gewonnen hat.
Doch nicht jeder Mitgliedstaat ist von dieser Zukunftsvision überzeugt. Das prominenteste Beispiel ist sicherlich das Vereinigte Königreich, das sich 2016 entschied, die Union zu verlassen. Im Nachhinein wird das Vereinigte Königreich gerne als das schwarze Schaf der Union abgetan: Es hätte ja eh nie wirklich Mitglied sein wollen und würde geradezu peinlich seiner Vergangenheit als Weltmacht hinterhertrauern. Doch auch andere Mitgliedsstaaten stehen einer weiteren politischen Integration kritisch gegenüber, ohne ebenfalls einen Austritt anzustreben. Blicken wir beispielsweise auf die direkten Nachbarn des Vereinigten Königreiches: Irland spricht sich seit je her dagegen aus, dass die Kompetenzen der EU-Kommission ausgebaut werden. Gleichzeitig weist der Mitgliedstaat EU-weit eine der höchsten Zustimmungsraten auf und gilt als klar pro-europäisch. Woher rührt also ihre Skepsis?
Keine andere Wahl
Bevor Irland 1973 der EU betrat, galt die junge Republik als eines der isoliertesten Länder Europas. Die einzigen wirtschaftlichen und politischen Verbindungen bestanden zum Vereinigten Königreich. Als dieses die EU-Mitgliedschaft anstrebte, blieb Irland keine andere Wahl, als sich dem Vorhaben anzuschließen. Dieser Kontext prägte Irlands Beziehungen zur EU nachhaltig: Souveränität und der Schutz des nationalen Interesses sind die vorherrschenden Themen in der irischen Politik. Innenpolitisch wurde die EU-Mitgliedschaft mit der Notwendigkeit begründet, die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich zu stärken. Durch den Beitritt zur EU erlangte Irland einen größeren Handlungsspielraum in der Beziehung zum Vereinigten Königreich.
Aufgrund dieser Erfahrung zeigt sich die Republik misstrauisch gegenüber dem Einfluss, den größere Staaten und die supranationale Entscheidungsinstitutionen der EU auf einen kleinen Staat wie Irland haben könnten. Auf EU-Ebene möchte Irland seine nationalen Interessen durch nationale Politiker durchsetzen. Deshalb dient der Europäische Rat als primärer Bezugspunkt für die irischen Akteure. Im Verhältnis zur EU pflegt Irland einen ausgeprägten Pragmatismus. Das nationale Interesse wurde immer über die große Idee der europäischen Einigung gestellt.
Souveränität gewinnen statt verlieren
Mitgliedstaaten wie Irland haben und hatten nie Interesse daran, die Vereinigten Staaten von Europa zu gründen. Für sie bietet die EU einen sicheren Hafen, um die eigene Souveränität zu sichern. Seit ihrem Beitritt vor fast 50 Jahren hat Irlands Wirtschaft enorm von der EU-Mitgliedschaft profitiert. Außerdem konnte die Republik ihre asymmetrischen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich verbessern und den Nordirlandkonflikt entschärfen. Diese Verbesserungen werden mit einer hohen Zustimmungsrate für die EU belohnt. Gleichzeitig zweifelt Irland daran, ob alle Mitgliedstaaten von den EU-Institutionen gleichberechtigt vertreten werden.
Jüngst zeigte sich das Misstrauen gegenüber dem Einfluss der Europäischen Kommission bei den Brexit-Verhandlungen. Im Vorfeld forderte Irland, dass allein der Europäische Rat die Verhandlungsbefugnis für die Austrittsgespräche haben sollte. Damit wäre die Einflussnahme der Staats- und Regierungsoberhäupter gesichert. Als die Kommission jedoch im Laufe der Verhandlungen Irlands nationale Interessen zu schützen schien, stieg das Vertrauen Irlands in jene. Letztlich war es diese positive Erfahrung, die Irland dazu bewog, die Autorität der EU-Kommission bei den Verhandlungen zu akzeptieren.
Mehr Realismus im Umgang mit kleinen Mitgliedstaaten
Seit dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU hat sich Irland politisch immer weiter von Großbritannien entfernt und stattdessen auf die EU zubewegt. Die irische Regierung sieht darin nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern betont immer wieder die Notwendigkeit der EU für die Friedenssicherung.
Aus Perspektive der EU ist diese Entwicklung selbstredend begrüßenswert. Allerdings darf dieses Verhältnis nicht romantisiert werden, wie es beispielsweise das Auswärtige Amt mit dem überzeugend klingenden Artikel „Irland nach dem Brexit: Europäisch, jetzt erst recht!“ tut. Sicher ist es wichtig, das Vertrauen in die EU-Kommission zu stärken und es darf sich über Erfolge gefreut werden. Aber: Es muss auch mehr Realismus im Umgang mit kleinen, peripheren Staaten in der Europäischen Politik geben.
Wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa.
Nous voulons les États-Unis d'Europe.
We want the United States of Europe.— Martin Schulz (@MartinSchulz) December 7, 2017
Große Staaten wie Deutschland und Frankreich haben bei einem wachsenden Einfluss der EU-Kommission keinen Machtverlust zu befürchten. Staaten wie Irland hingegen mussten Jahrzehnte lang für ihre nationale Unabhängigkeit kämpfen und können die nationalen Interessen im Zwischenspiel der EU-Institutionen nur bedingt durchsetzen. Irlands pro-europäische Haltung ist durch den Nutzen der EU für irische Interessen entstanden und nicht, weil es an ein übergeordnetes Ziel eines vereinigten Europas glaubte. Insofern darf das wachsende Vertrauen nicht als Zustimmung zu einem wachsenden Einfluss der EU-Kommission missverstanden werden. Pro-europäisch heißt nicht gleich pro-supranational.




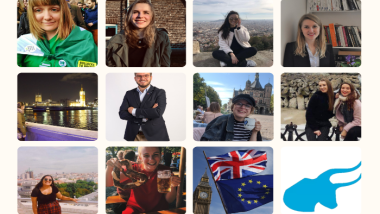
Kommentare verfolgen: |
|
